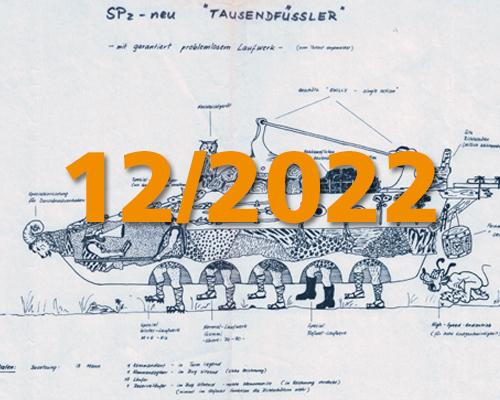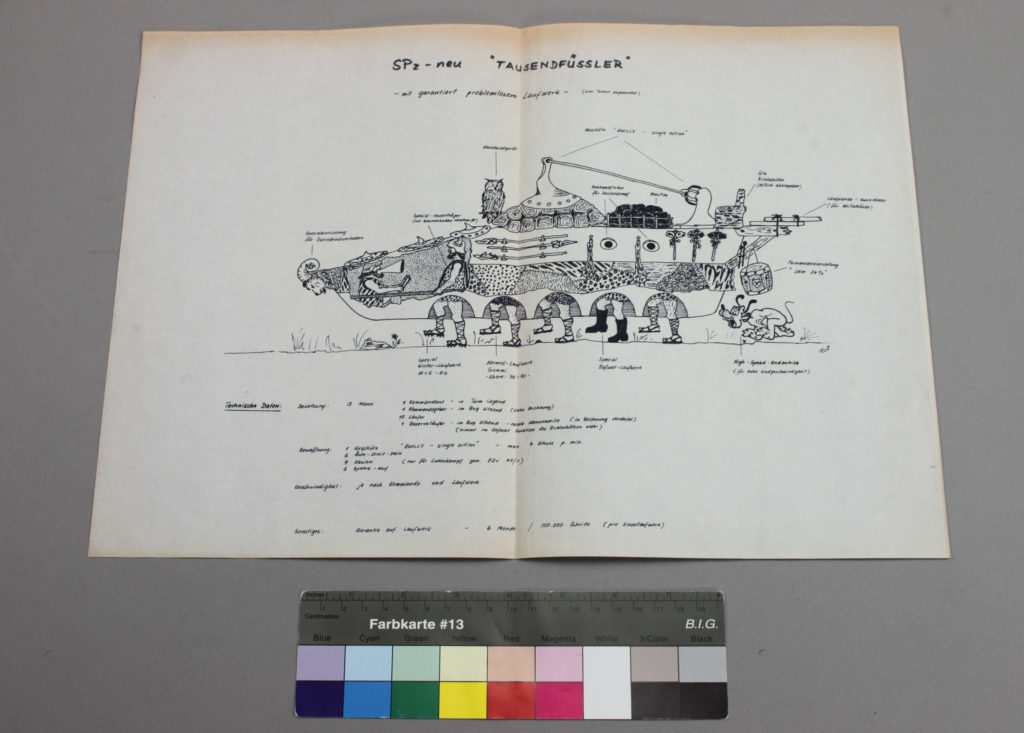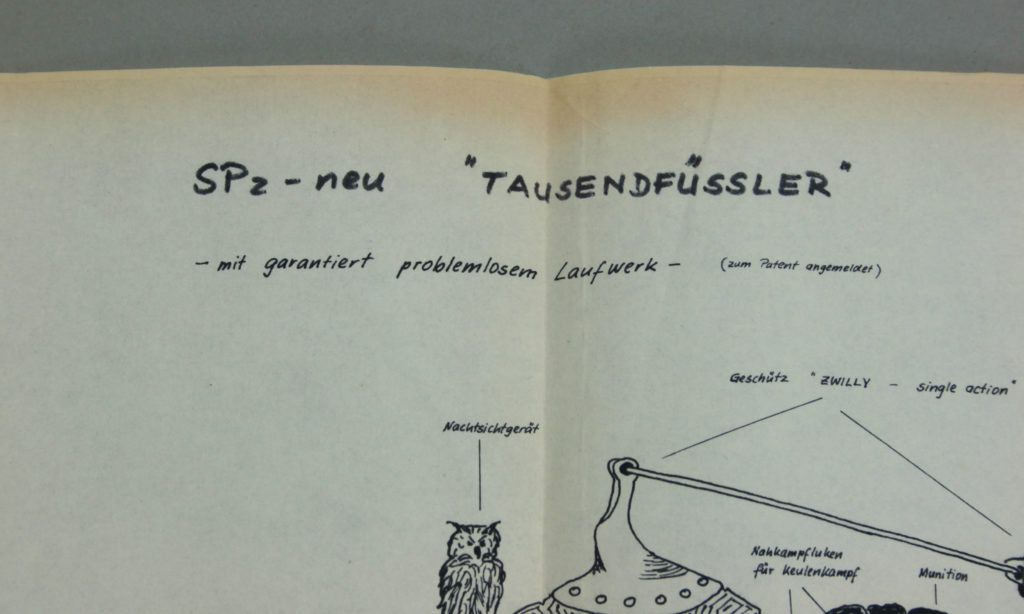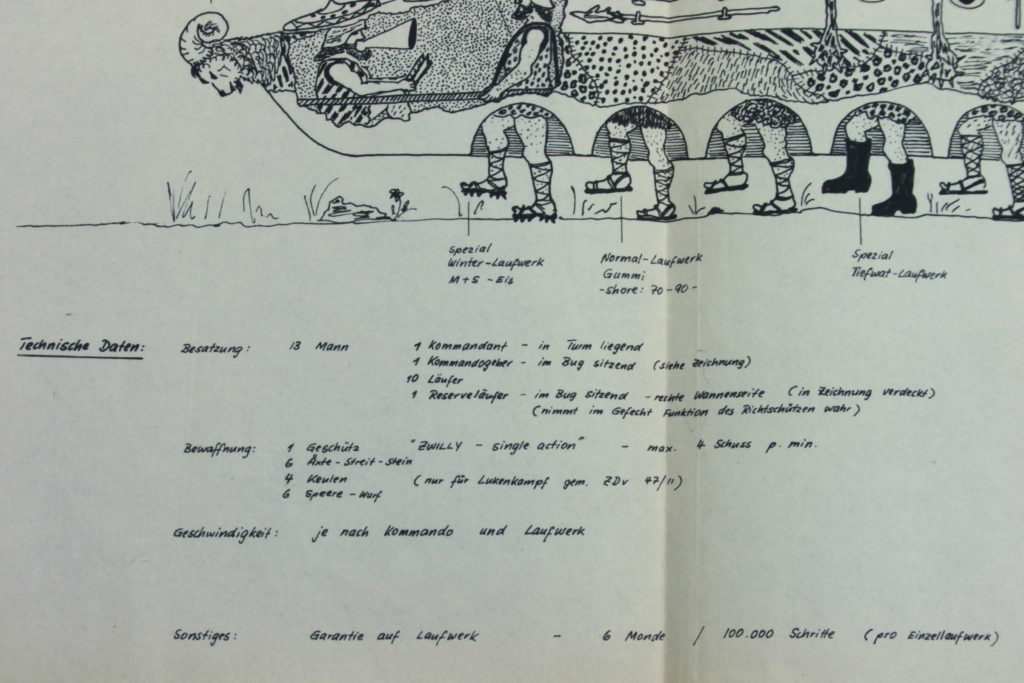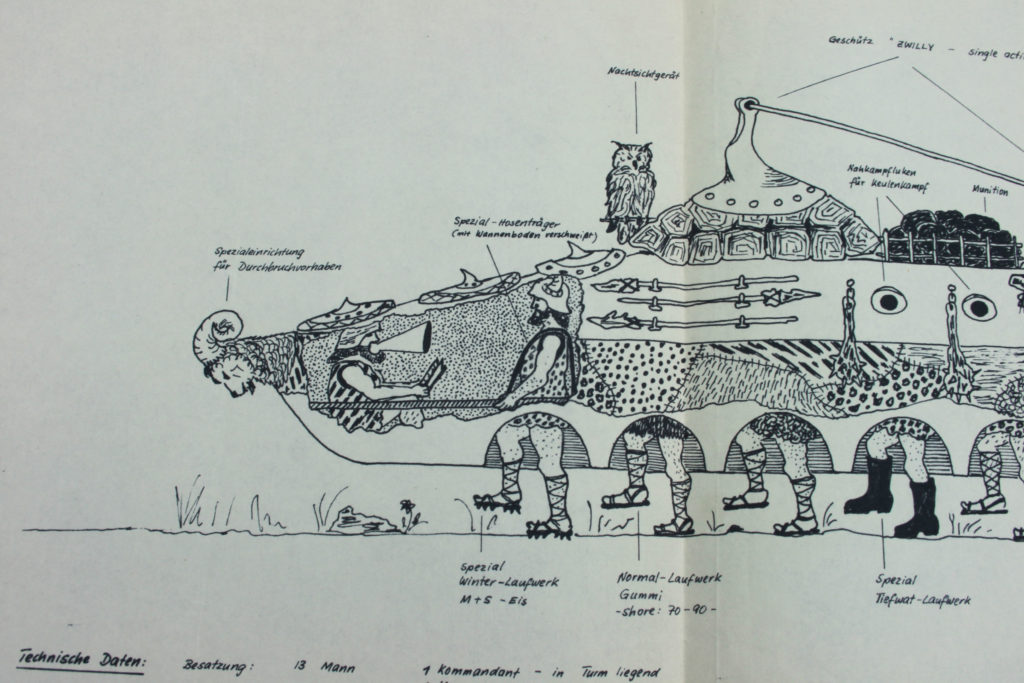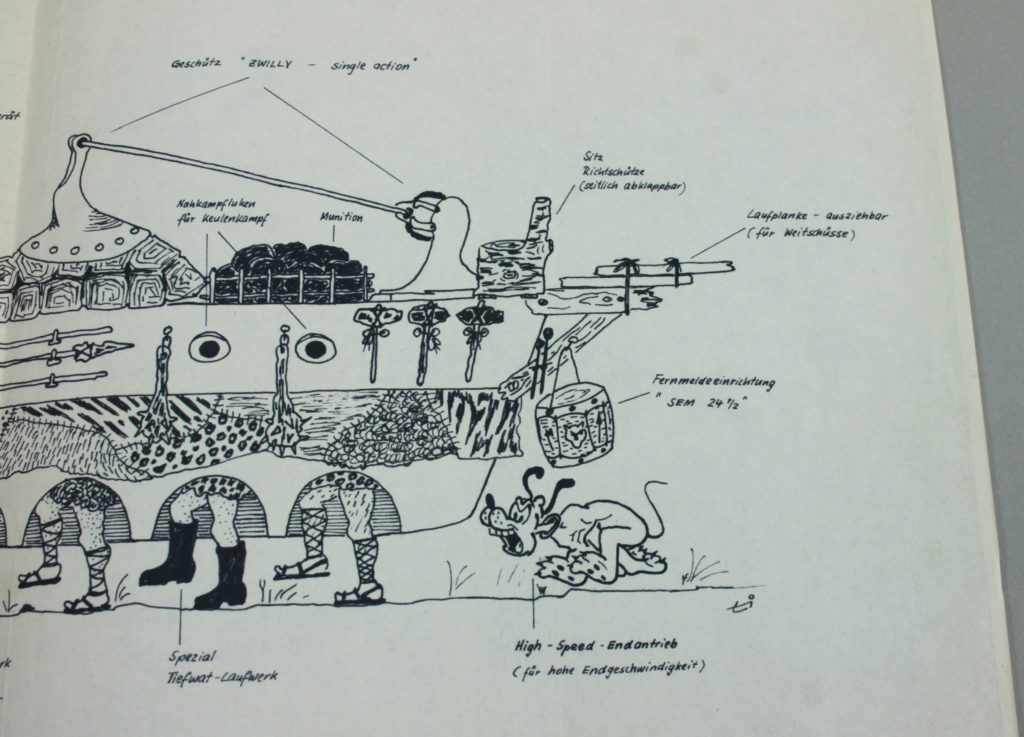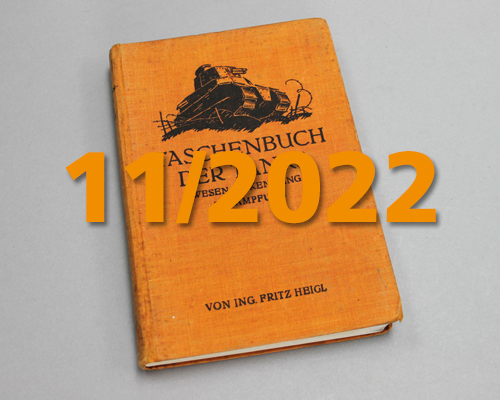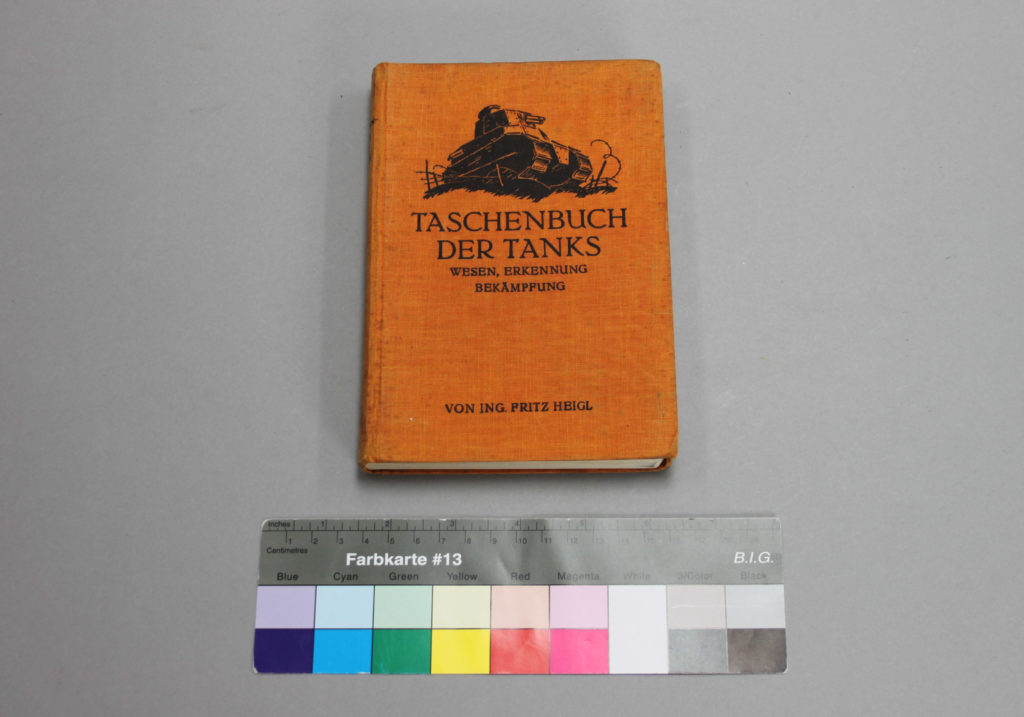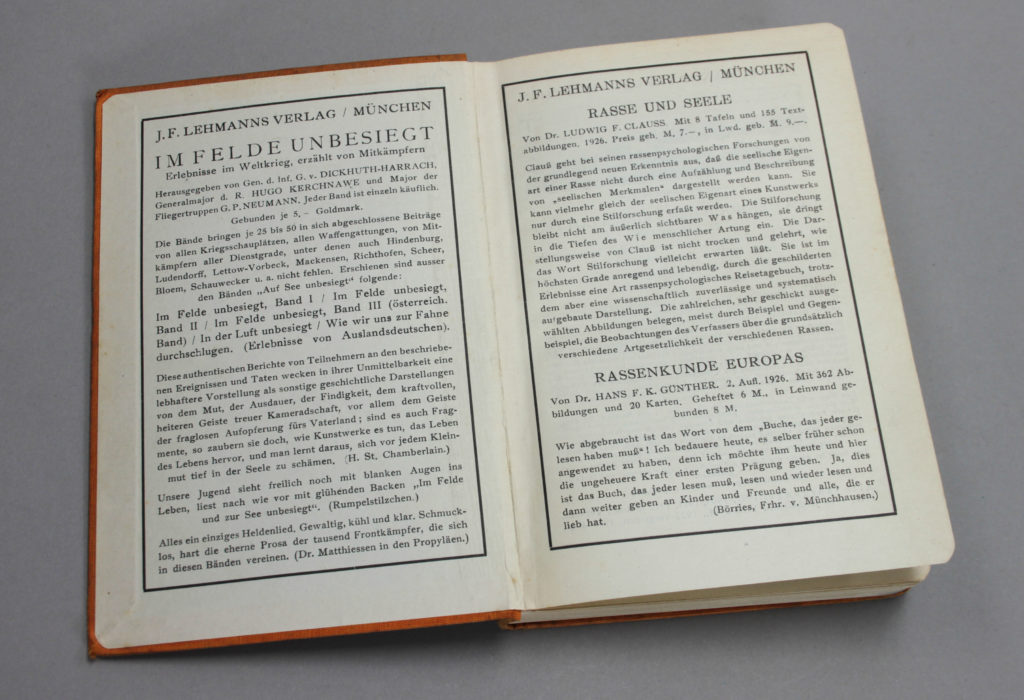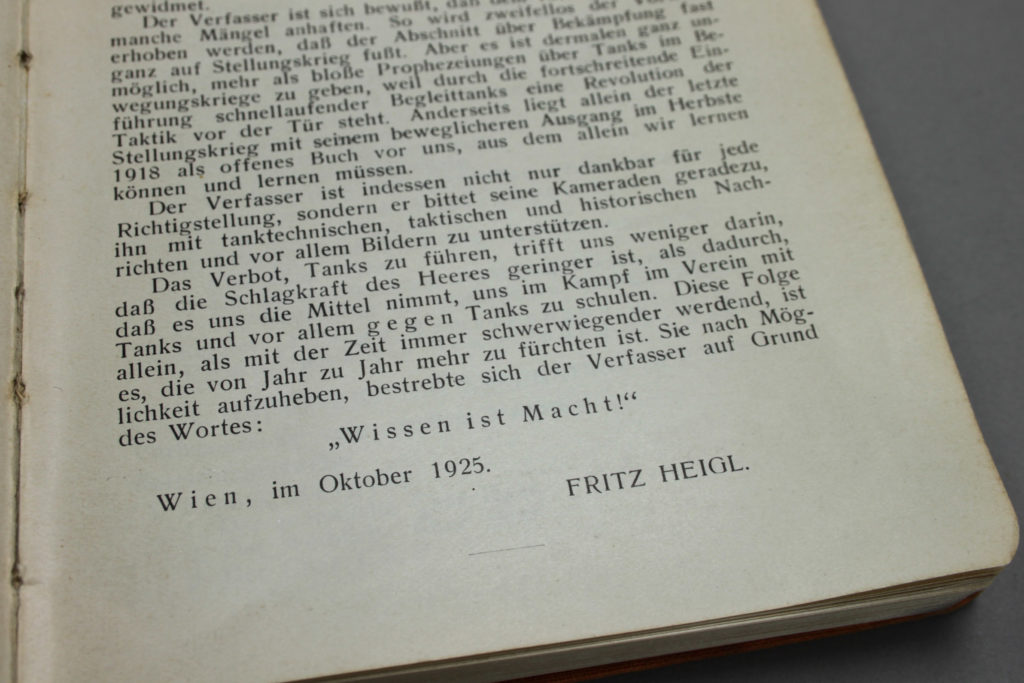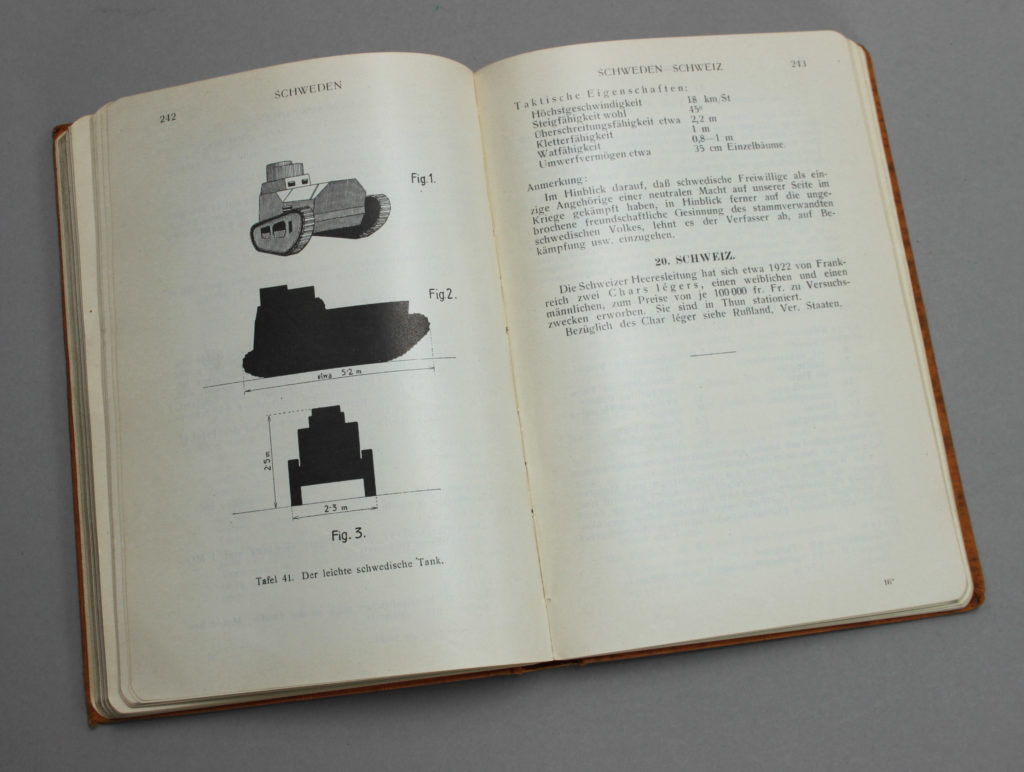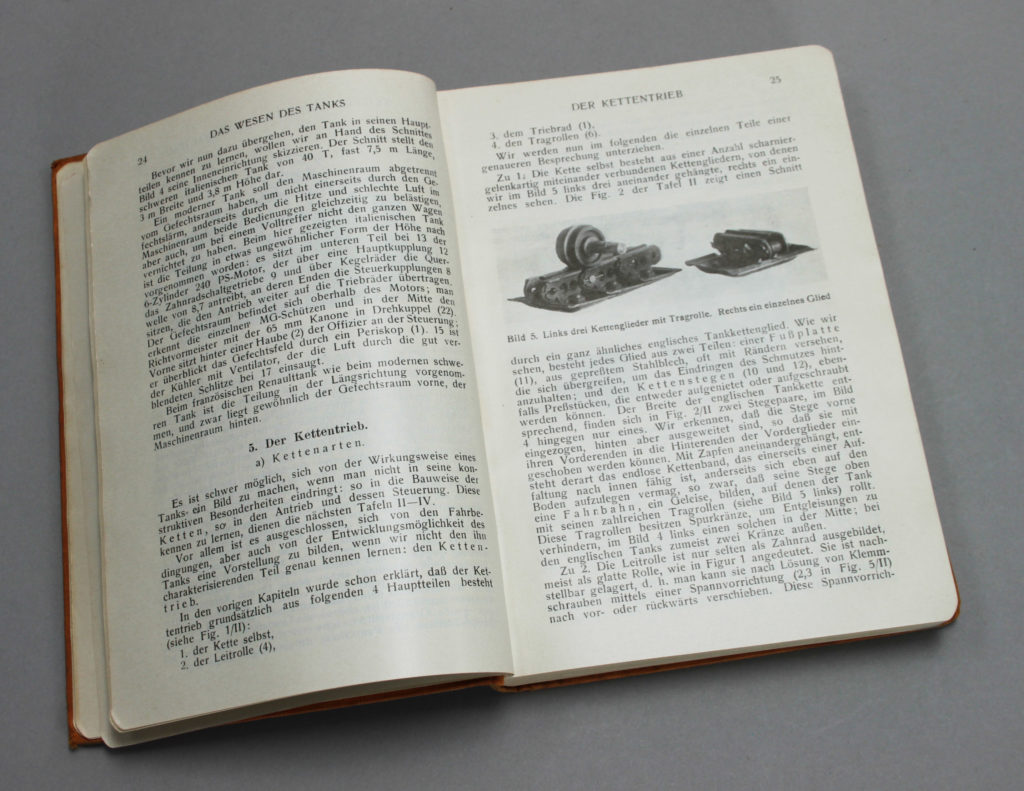Objekt des Monats 01/2023
Beim Objekt des Monats erzählen wir die (Kurz-) Geschichte eines besonderen Objekts aus dem Panzermuseum. Da wir uns bemühen auch besonders Stücke aus dem Depot vorzustellen, finden sich hier auch ungewöhnliche Objekte und spannende Geschichten
Stein mit Farbsprenkeln von Farbanschlägen, 2019
Inv. Nr.: DPM 7.266
In seiner mittlerweile 40-jährigen Geschichte war das Panzermuseum Ziel von viel Zuspruch, aber auch von Kritik. Museen dokumentieren auch ihre eigene Geschichte in Objekten. Dieser Stein zeugt mit roten und rosafarbenen Sprenkeln von zwei Farbanschlägen, die das Museum trafen. In beiden Fällen wurde ein Standardpanzer der 0-Serie, der vor dem Museumsgelände ungesichert auf einem Eisenbahnanhänger in einem Kiesbett stand, mit Farbe bespritzt. Diese Farbe tropfte auf die darunterliegenden Steine. In beiden Fällen richtete sich die Aktion jedoch nicht nur gegen das Museum als Kulturinstitution, sondern stellvertretend auch für die Bundeswehr und Verteidigungspolitik der Bundesregierung.
Im Jahr 2012 verübte die autonome Gruppe „Rosa Tank Gang“ den ersten Farbanschlag auf das Museumsobjekt. Sie übergossen den Panzer mit rosa Farbe und warfen Farbbeutel über den Zaun des Museumsgeländes in den Eingangsbereich. Anlass der Aktion war die in dieser Nacht erfolgte Inhaftierung von Hanna Poddig. Die Aktivistin hatte sich im Jahr 2008 an Bahngleise gekettet und so mit anderen Demonstrant:innen den Transport von Bundeswehrfahrzeugen zu einem Manöver blockiert. Poddig wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Sie entschied sich stattdessen, im Jahr 2012 eine 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Frankfurt anzutreten. Der Farbanschlag am Panzermuseum richtete sich laut Bekennerschreiben „gegen die kriegerischen und wirtschaftlich motivierten Einsätze der Bundeswehr im Ausland“. Es traf das Museum, weil dies angeblich „seit Jahren für eben diese verherrlichenden Darstellungen von Krieg, Verbrechen und Mord bekannt ist. Es dient ausschließlich der Propaganda. Insbesondere Kindern und Jugendlichen wird hier ein total verklärtes Bild von Militär und Krieg vermittelt.“ Auf Gesprächsangebote seitens des Museums ging die Gruppe nicht ein. Die verwendete rosa Farbe konnte wieder vom Panzer entfernt werden.
Der zweite Farbanschlag gegen den Panzer vor dem Museumsgelände im Jahr 2019 wurde mit roter Lackfarbe ausgeführt. Das Fahrzeug wurde mit dem Symbol „Hammer und Sichel“ und dem Ausspruch „Krieg dem Krieg“ angestrichen. Der Ausspruch war wohl angelehnt an das berühmte Antikriegswerk „Krieg dem Kriege“ von Ernst Friedrich von 1924. Anders als beim ersten Farbanschlag gab es kein Bekennerschreiben. Die Lackfarbe richtete mehr Schaden am Objekt an und auch das kontaminierte Erdreich musste fachgerecht entsorgt werden. Angesichts der aufwendigen Reinigung des Objekts entschieden sich die Träger des Museums daraufhin, die Inszenierung zu entfernen und den Panzer im Museumsdepot einzulagern. Für das Panzermuseum hatte vor allem der erste Farbanschlag ironischerweise einen großen Vorteil: Der Schaden war gering, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit groß. Der Vorfall wurde in der nationalen Presse wie Spiegel, Stern und Morgenpost thematisiert. Die Social-Media-Kanäle des Museums erhielten schlagartig mehr Zulauf und die Stellungnahme des Museums zum Farbanschlag mit dem angekündigten Transformationsprozess des Museums, nahmen so viel mehr Menschen wahr. Seitdem erreicht das Museum eine zunehmende Zahl an Menschen mit seinen Inhalten.