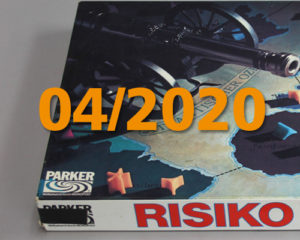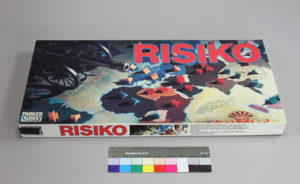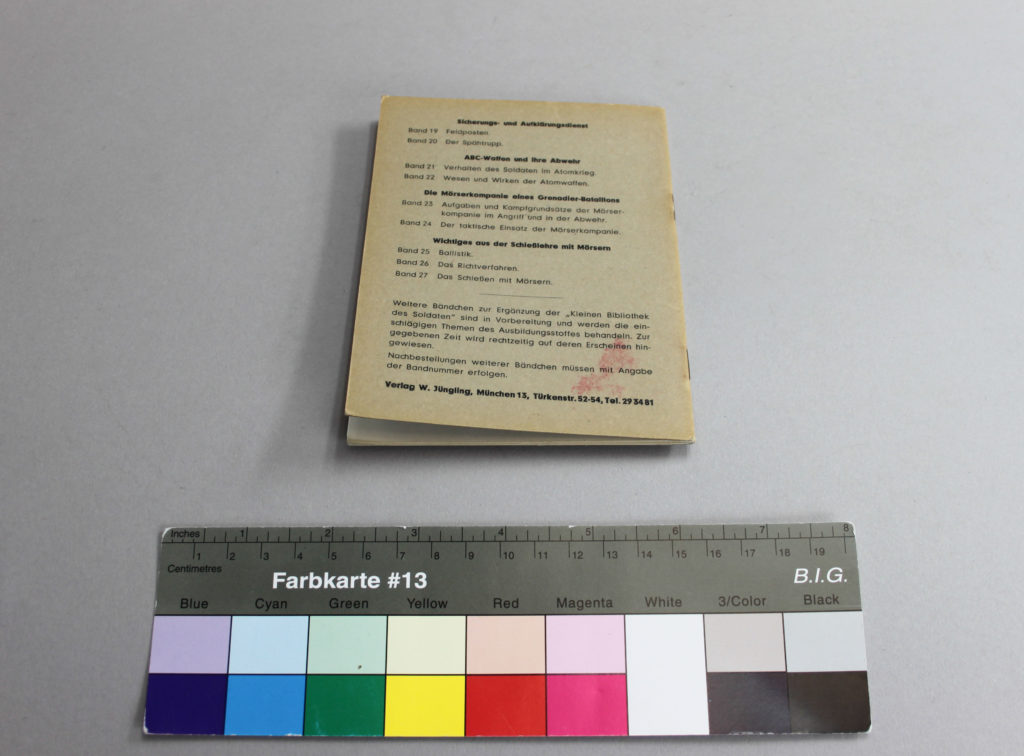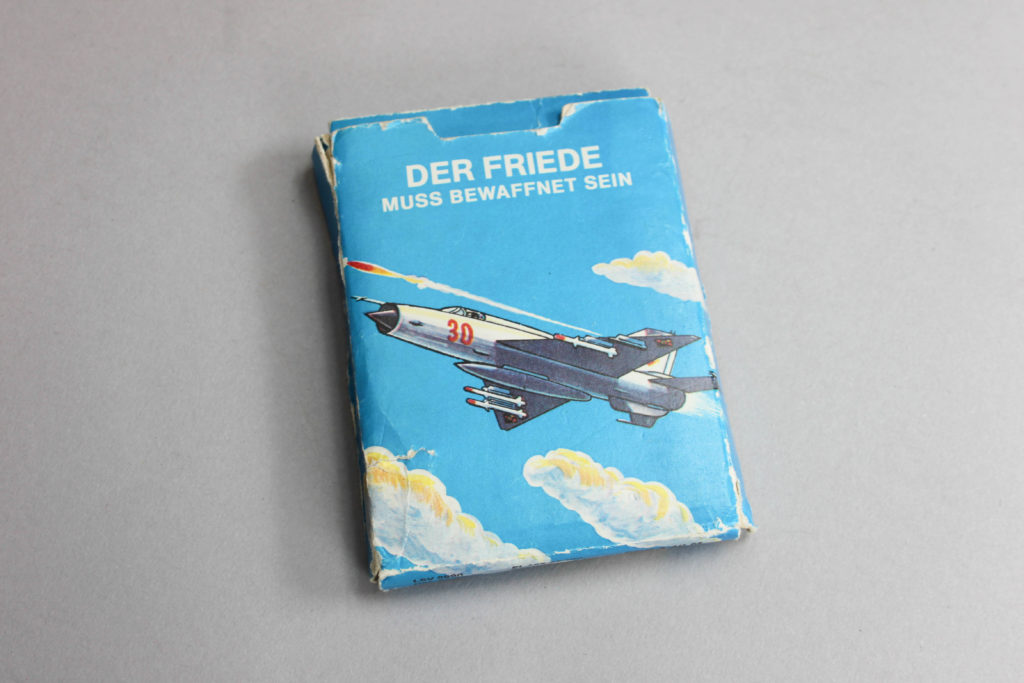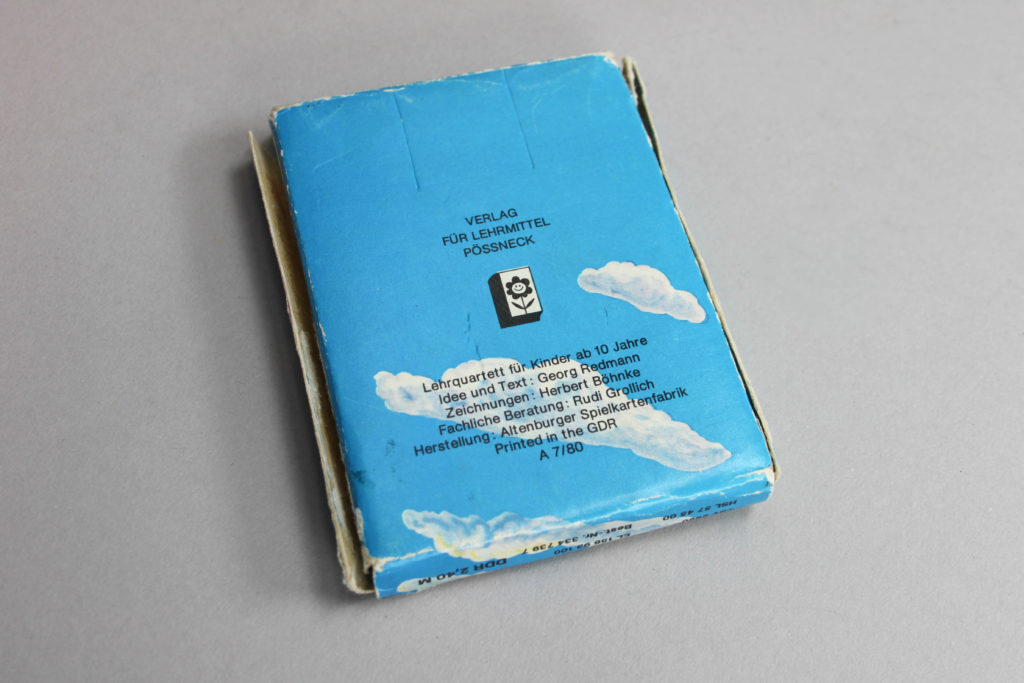Objekt des Monats 06/2020
Beim Objekt des Monats erzählen wir die (Kurz-) Geschichte eines besonderen Objekts aus dem Panzermuseum.
Da wir uns bemühen auch besonders Stücke aus dem Depot vorzustellen, finden sich hier auch ungewöhnliche Objekte und spannende Geschichten
Veteranenabzeichen der Bundeswehr
Inv. Nr.: DPM 3.2548
Das Veteranenabzeichen der Bundeswehr ist ein kleines, silberfarbenes Eisernes Kreuz, welches in der Mitte den Bundesadler trägt. Das Abzeichen darf nicht an der Uniform, sondern nur an Zivilkleidung getragen werden. Dies ergibt sich aus seiner Intention, eine Solidaritätsbekundung zur Bundeswehr in der zivilen Öffentlichkeit zu symbolisieren. Seiner offiziellen Einführung 2018 ging eine mehrjährige Debatte voraus, welche sich vornehmlich um die Definition des Begriffes „Veteran“ drehte. Von ihr hing ab, wer das Abzeichen erhalten durfte.
Bereits 2013 wurden 10.000 Abzeichen unter dem damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maizière beschafft. Ohne gültige Veteranendefinition konnten sie jedoch nicht verliehen werden. Obwohl nur wenige zuvor als Ansichtsexemplare ausgegeben wurden, tauchten bereits zahlreiche Stücke im Onlinehandel auf. Woher die zum Kauf angebotenen Abzeichen stammten, wurde nicht geklärt.
De Maizière definierte 2012 nur diejenigen Soldatinnen und Soldaten als Veteranen, die eine Einsatzmedaille der Bundeswehr erhalten hatten. Dies schließt jedoch Angehörige der Streitkräfte, die beim ersten Einsatz in Somalia 1993 teilnahmen aus, da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Einsatzmedaille gab. De Maizière erweiterte seine Definition 2013 um alle, die an einem Bundeswehreinsatz teilgenommen hatten, doch während seiner Amtszeit konnte keine Einigung erreicht werden. Während der Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V. nur diejenigen Soldatinnen und Soldaten, welche an Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilgenommen haben, als „Veteran“ bezeichnet sehen wollten, setzte sich der Bundeswehrverband und Reservistenverband für eine breitere Definition ein. De Maizières Nachfolgerin Ursula von der Leyen versuchte mit einer zweistufigen Definition von „Veteranen“ und „Einsatzveteranen“ zunächst einen Kompromiss, einige Interessenvertretungen der Bundeswehr lehnten dies jedoch als „Zwei-Klassen-Modell“ ab.
Im Tagesbefehl zum Veteranenbegriff vom 26.11.2018 heißt es nun: „Veteranin oder Veteran der Bundeswehr ist, wer als Soldatin oder Soldat der Bundeswehr im aktiven Dienst steht oder aus diesem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist, also den Dienstgrad nicht verloren hat.“ Hiermit ist der Veteranenbegriff nun erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik festgelegt. Die Verteidigungsministerin fasste den Begriff bewusst möglichst weit, um alle Personen einzuschließen, die in der Bundeswehr gedient haben. Die erste Verleihung erfolgte am 15. Juni 2019 am Tag der Bundeswehr in Faßberg.
Das Veteranenabzeichen kann jede Soldatin und jeder Soldat beantragen die oder der bei der Bundeswehr gedient hat. Eine Mindestdienstzeit gibt es nicht, jedoch darf die Person nicht unehrenhaft ausgeschieden sein, wodurch ca. 10 Millionen Menschen berechtigt sind, das Abzeichen zu tragen. Bis Januar 2020 gingen fast 40.000 Anträge für das Abzeichen ein.