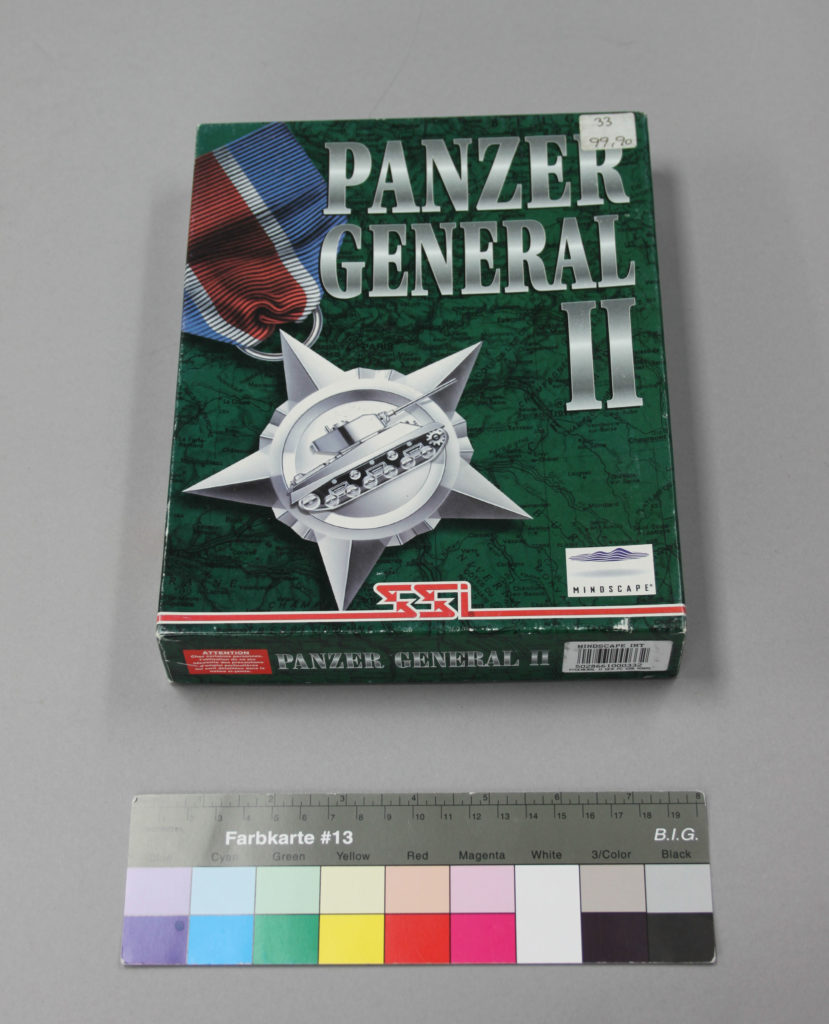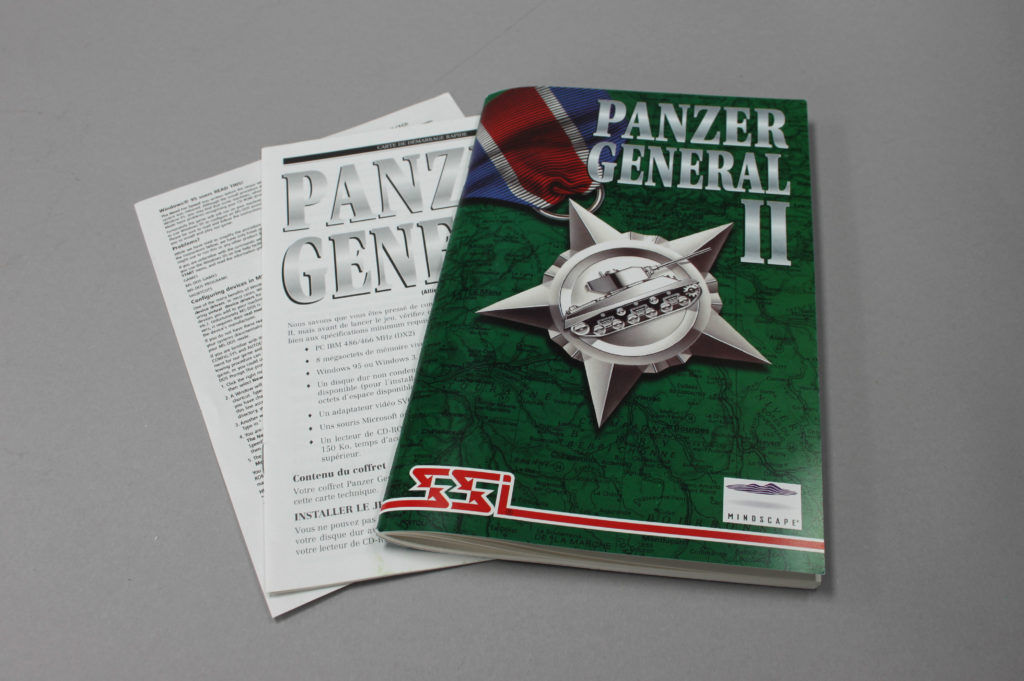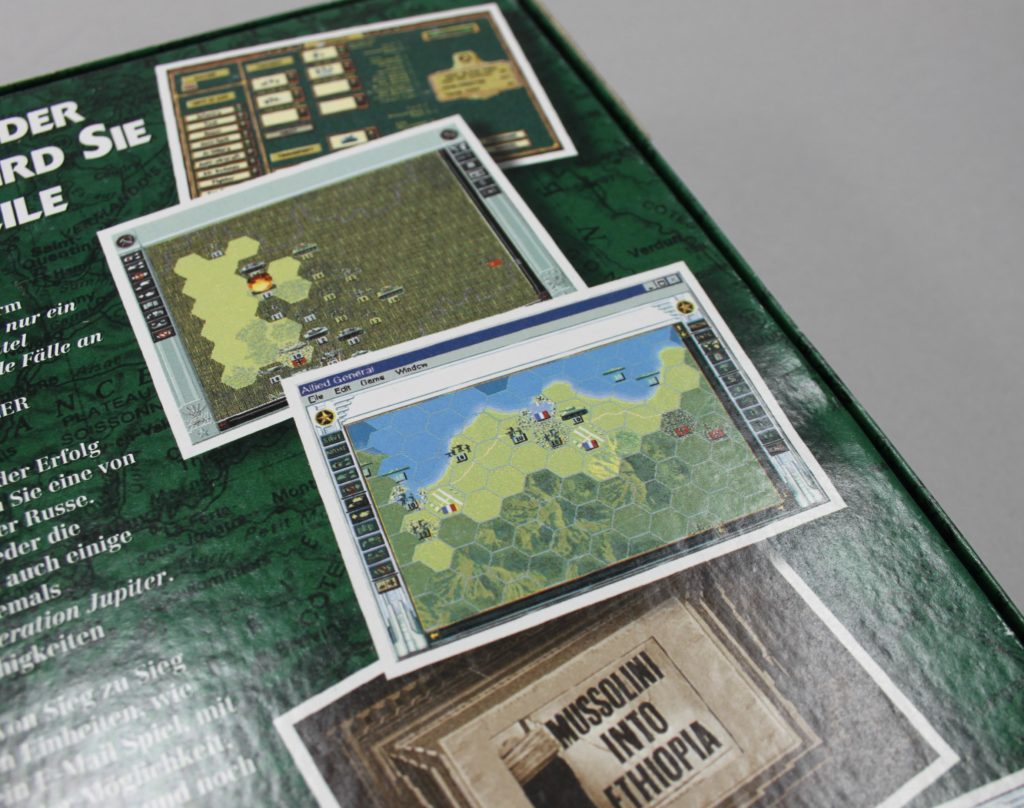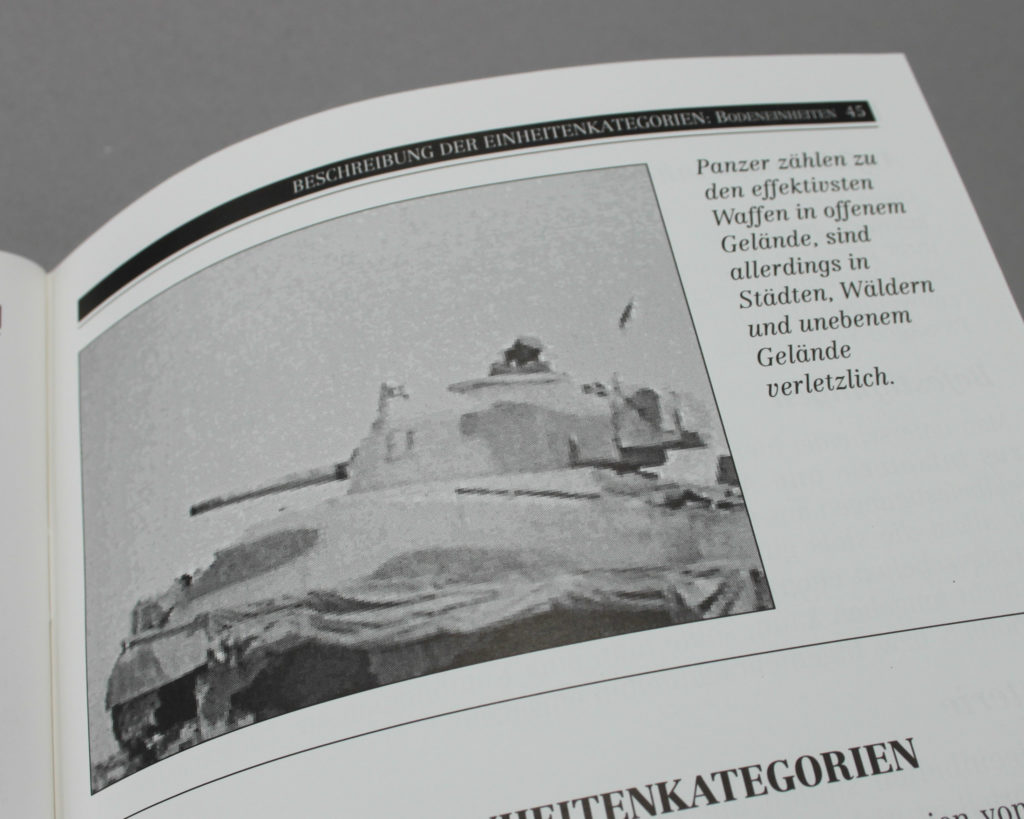Objekt des Monats 12/2019
Beim Objekt des Monats erzählen wir die (Kurz-) Geschichte eines besonderen Objekts aus dem Panzermuseum.
Da wir uns bemühen auch besonders Stücke aus dem Depot vorzustellen, finden sich hier auch ungewöhnliche Objekte und spannende Geschichten
Oderflutmedaille 1997
Inventarnummer: DPM 3.2536
Im Sommer 1997 ereignete sich das größte bekannte Oderhochwasser der Geschichte. Große Flächen in Polen, Tschechien und Deutschland wurden überflutet, es gab 114 Todesopfer. Die Bundeswehr beteiligte sich mit insgesamt 30.000 Soldaten, Pionierpanzern, Hubschraubern, LKWs, Booten und Tornado-Flugzeugen an der Fluthilfe. Sie war damit der größte Katastrophenschutzeinsatz in der Geschichte der Bundeswehr.
Einem Einsatz der Bundeswehr im Inneren setzt das Grundgesetz sehr enge Grenzen, um die Trennung zwischen militärischen und polizeilichen Aufgaben zu gewährleisten. Ein Einsatz ist nur im Rahmen eines Notstandes möglich – oder als sogenannte Amtshilfe. Seit Aufstellung der Bundeswehr leistete sie regelmäßig bei Sturmfluten und Waldbränden oder als Erntehelfer Amtshilfe. Das Ausmaß und der Anlass eines Bundeswehreinsatzes im Inneren ist jedoch immer wieder Anlass zur Diskussion, zum Beispiel als im Februar 1962 die Elbe über die Ufer trat und Teile Schleswig-Holsteins, Niedersachsens, Hamburgs und Bremens überflutete und die Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe Personen rettete. Dieser Amtshilfebeitrag der Bundeswehr wurde zur Etablierung neuer Notstandsgesetze im Jahr 1968 instrumentalisiert.
Der Einsatz der Bundeswehr in Ostdeutschland 1997 erhielt jedoch bundesweite Anerkennung. Noch im August 1997 stiftete der damalige Ministerpräsident Brandenburgs, Manfred Stolpe, eine Medaille zur Auszeichnung der Einsatzkräfte. Sie ist damit keine militärische Auszeichnung, sondern wurde an alle beteiligten Kräfte verliehen. Die Personen mussten zuvor für eine Verleihung vorgeschlagen werden. Die Medaille am Rot-Weißen Band zeigt den brandenburgischen Adler, der von den Worten „In Dankbarkeit und Anerkennung – Oderflut 1997“ gerahmt wird. Auf der Rückseite finden sich die Umrisse der von der Flut betroffenen Regionen in Polen und Deutschland mit den Flussläufen der Oder.