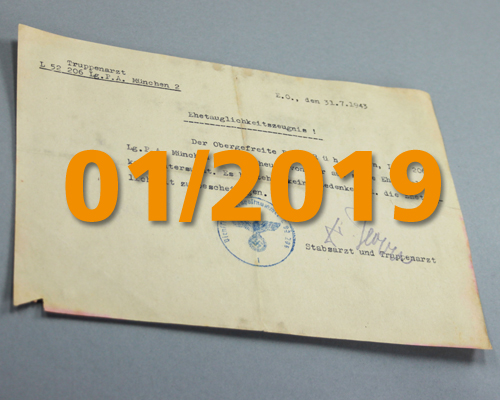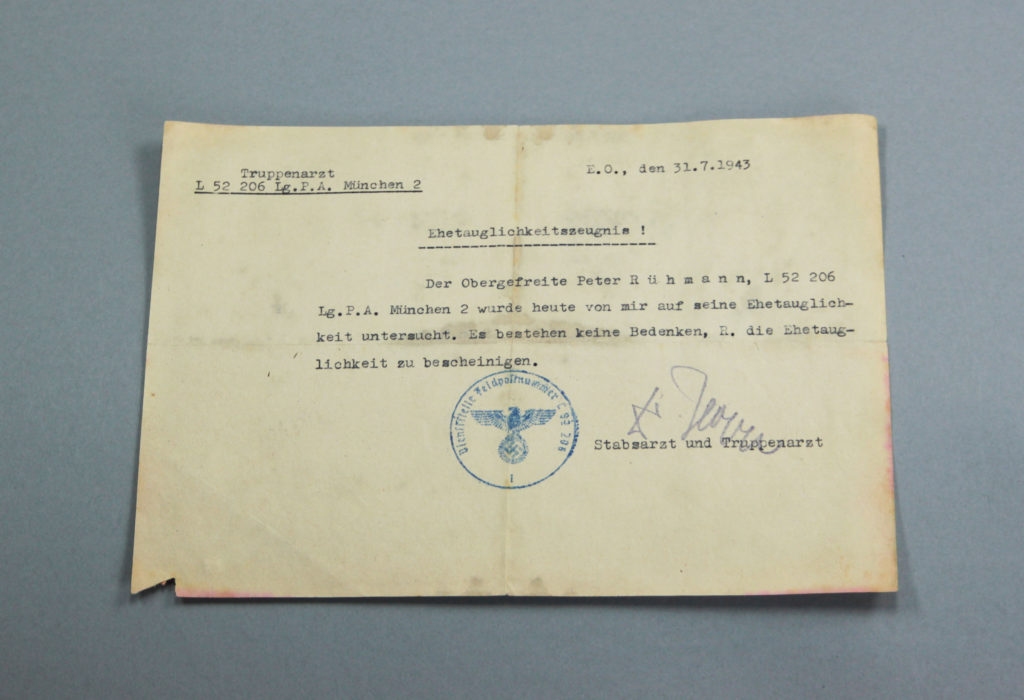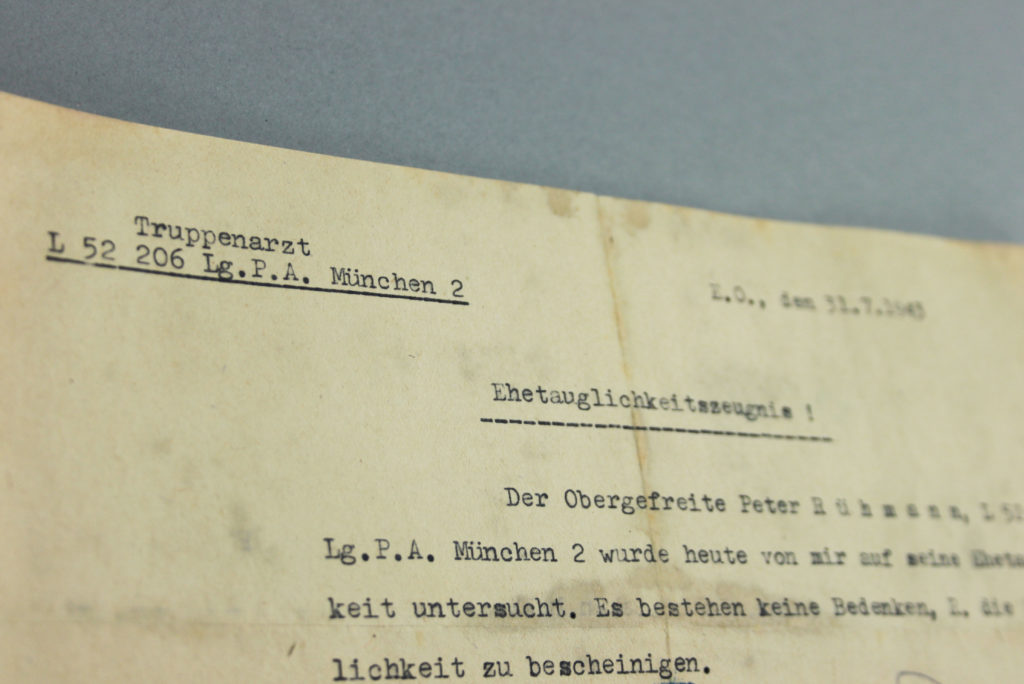Objekt des Monats 06/2019
Beim Objekt des Monats erzählen wir die (Kurz-) Geschichte eines besonderen Objekts aus dem Panzermuseum.
Da wir uns bemühen auch besonders Stücke aus dem Depot vorzustellen, finden sich hier auch ungewöhnliche Objekte und spannende Geschichten
Infoheft der Bürgerinitiative Amelinghausen
Inventarnummer: DPM 6.1502
Die Lüneburger Heide bietet mit ihrer einmaligen Landschaft Einheimischen sowie Touristinnen und Touristen Erholung und frische Luft. Das Naturschutzgebiet um den Wilseder Berg bildet eines der größten zusammenhängenden Heidegebiete Europas und wurde bereits 1921 unter Schutz gestellt. Doch neben Heidschnucken, Fahrrädern und Pferdekutschen bevölkerten vor nicht allzu langer Zeit noch zahlreiche Panzer die Straßen und Felder der Region.
Dies erlaubte das zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Nordirland und Kanada im Jahr 1963 abgeschlossene Soltau-Lüneburg-Abkommen, nach welchem gekennzeichnete „Rote Flächen“ der Naturschutzgebiete für militärische Zwecke genutzt werden durften. Hierfür mussten auch private Grundstückseigner sowie der Verein Naturschutzpark e.V., der einen großen Teil der Heide nach Vorbild der US-amerikanischen Nationalparks ankaufte und verwaltete, ihr Eigentum zur Verfügung stellen. In Deutschland stationierte Truppen der Alliierten führten darin Übungen durch, die Bundeswehr war hiervon ausgeschlossen. Die Schäden an Straßen, Feldern und Privatgrundstücken durch Panzer und zahlreiche Unfälle sind vielen Bürgerinnen und Bürgern der Region bis heute im Gedächtnis geblieben. Zwar ging ein Ausschuss diesen Schäden nach und sorgte für eine Entschädigung, die Heidelandschaft der Roten Flächen glich jedoch zunehmend einer Einöde.
Die Bürgerinitiative Amelinghausen gründete sich 1988 als Umweltschutzverein mit dem vollen Namen „Bürgerinitiative für Umweltschutz durch Verringerung militärischer Belastungen Amelinghausen e.V.“ Das Deckblatt des Infoheftes zeigt eine Heidschnucke, die mit ihren Hörnern das Rohr eines Panzers verbiegt. In dieser Zeit bildete sich auch die Bürgerinitiative Schneverdingen zur Erhaltung von Natur- und Kulturstätten der Heideregion. Beide wandten sich gegen die Umweltzerstörung durch die militärische Nutzung der Naturschutzgebiete, gegen die Umsiedlung von Bewohnerinnen und Bewohnern alter Heidedörfer zum Ausbau von Truppenübungsplätzen und forderten die Aufkündigung des Soltau-Lüneburg-Abkommens.
Nach 1989 erfolgten nach einer Neuverhandlung des Abkommens diverse Zugeständnisse an die Bürgerinnen und Bürger der Region: So durfte beispielsweise nicht mehr an Feiertagen, Wochenenden und in der Heideblütenzeit zwischen August und September geübt werden. 1994 wurde das Abkommen aufgelöst. Seitdem restauriert der Verein Naturschutzpark e.V. und dessen Stiftung seine Flächen, unter anderem mit EU-Mitteln.